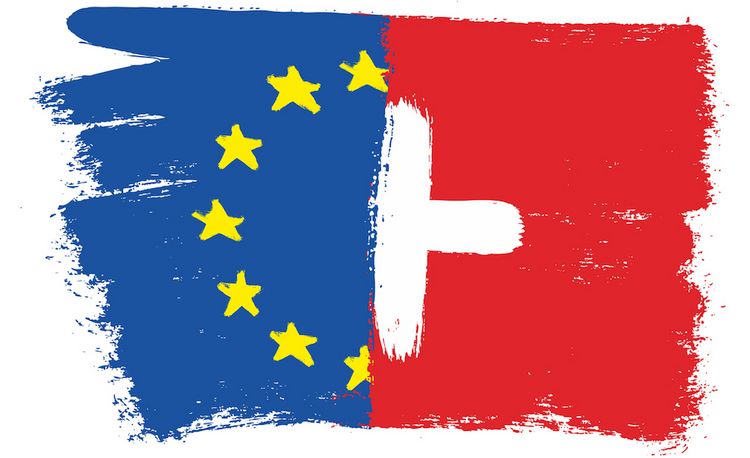Dass die Schweiz sämtliche Voraussetzungen für die unbeschränkte Anerkennung der Gleichwertigkeit der schweizerischen Börsenregulierung durch die EU erfüllt, ist von der Europäischen Kommission zu keiner Zeit infrage gestellt worden.
Der Poker mit dem Faustpfand der Börsenäquivalenz zielt einerseits auf die Schweiz, um die Eidgenossen beim Rahmenabkommen auf den gewünschten Kurs der EU zu bringen. Auf der anderen Seite lässt sich damit ein Exempel statuieren, um den möglicherweise widerborstigen Briten im Zusammenhang mit dem Brexit den Schneid abzukaufen und die klare Message auf die Insel zu senden: die EU kann richtig böse werden, wenn ihre Partner (?) nicht spuren.
Die Drohkulisse wird möglicherweise zur fixen Installation
Die Börsenäquivalenz und deren unbefristete Verlängerung wurde und wird von der EU schlicht als Druckmittel eingesetzt, um der Schweiz beim Tempo der erwarteten Unterzeichnung des Rahmenabkommens "Beine zu machen" und die aktuell noch strittigen Punkte im Sinne der EU lösen zu können.
Es zeichnet sich ab, dass die Börsenäquivalenz, welche die Europäische Kommission der Schweiz nur noch befristet gewährt hatte, nicht über Ende Juni hinaus verlängert wird.
Das EFD ist bereit
Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat gestern die Bereitschaft kommuniziert, die Massnahme zum Schutz der Schweizer Börseninfrastruktur mit Wirkung auf den 1. Juli 2019 zu aktivieren.
Der Bundesrat hatte diese Massnahme bereits am 30. November 2018 verabschiedet. Die entsprechende Verordnung sieht eine Anerkennungspflicht für ausländische Handelsplätze vor, die Aktien von Schweizer Gesellschaften zum Handel zulassen.
Im Falle einer Nichtverlängerung der Börsenäquivalenz wird das EFD diese Schutzmassnahme gemäss Verordnung aktivieren. Konkret würde das EFD die Liste der Jurisdiktionen nach Artikel 3 Absatz 3 der entsprechenden Verordnung per 1. Juli 2019 anpassen und die EU in die Liste aufnehmen.
Dies hätte zur Folge, dass Handelsplätze in der EU die Anerkennung nach Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung verlieren würden. Handelsplätzen in der EU wäre es damit ab diesem Zeitpunkt untersagt, den Handel mit bestimmten Aktien von Schweizer Gesellschaften anzubieten oder zu ermöglichen.
Das EFD legt Wert auf die Feststellung, dass "eine Aktivierung der Schutzmassnahme in Bezug auf Handelsplätze in der EU einzig dazu dienen würde, die Funktionsweise der Schweizer Börseninfrastruktur zu schützen".
Auch SIX ist vorbereitet
In ihrer gestrigen Medienmitteilung bekräftigt SIX, dass sie die im November 2018 eingeführte Verordnung des Schweizerischen Bundesrates zur Wahrung der Interessen und Stärkung der Funktionsfähigkeit des Schweizer Kapitalmarktes nach wie vor begrüssen würde. Zumal diese Massnahme sicherstellen würde, dass EU-Marktteilnehmer weiter Zugang zum Schweizer Binnenmarkt haben und dort Schweizer Aktien handeln können, falls die Äquivalenzanerkennung definitiv nicht verlängert wird.
SIX meldet, sie habe sich auf diesen Fall vorbereitet, indem sie in den letzten sieben Monaten direkte Verbindungen zu allen Kunden aufgebaut habe, damit der Handel reibungslos weitergehen könne. Darüber hinaus habe SIX einen Prozess implementiert, um neuen Marktteilnehmern einen Schnellzugang zu ermöglichen.
Ein Kommentar
Die Schweiz ist für die EU kein einfacher Verhandlungspartner. Der Kern der verfahrenen Situation liegt in der Tatsache und im Unding, dass ein kleines Land als Nicht-EU-Region im Zentrum von Europa und damit im Herzen des EU-Raums liegt.
Hatte die Schweiz die verschiedenen bilateralen Verträge mit der Europäischen Union als langfristige Lösungen betrachtet, waren diese mühsam erarbeiteten Vertragswerke aus Sicht der EU eher eine Übergangslösung, bis die Schweiz zu einem EU-Beitritt bereit ist. Diese Bereitschaft liegt jedoch, aus zahlreichen Gründen, in weiter Ferne.
Deshalb drängt die EU auf ein institutionelles Rahmenabkommen, als zwingende Voraussetzung, um den bilateralen Weg überhaupt fortsetzen zu wollen. Entwicklung, Geschichte und strittige Punkte der Verhandlungen sind bekannt und brauchen nicht weiter ausgeführt zu werden.
Die Verstimmung der EU ist nachvollziehbar, die Position der Schweiz ebenfalls – und das lässt die Situation ziemlich auswegslos erscheinen. Dass die Europäische Kommission seit längerem mit der wiederholten Drohung operiert, die Börsenäquivalenz der Schweiz nicht verlängern zu wollen, hat nicht das gewünschte Wasser auf die Mühlen einer schnellen Einigung geleitet, sondern massiv Sand ins Getriebe gekippt und Öl ins Feuer gegossen.
Verständlich, weil Partner verhandeln sollen. Auch dann, wenn's schwierig wird. Auch dann, wenn's mühsam wird. Was als mehrfach ausgesprochene Drohung nach Erpressung riecht, ist eine peinliche und unwürdige Form der Verhandlungsstrategie. Und das erzeugt Widerstand. Weil das Bild des grossen Bruders, der dem kleinen sagt: Du hast zu parieren, sonst..., in der Schweiz und auch anderswo nicht gut ankommt. Zumal die Börsenäquivalenz mit dem Rahmenabkommen null und nichts zu tun hat – es ist einfach ein Bereich, der dazu herhalten muss, den Kleinen unter Druck zu setzen und Mores zu lehren.
Die Europäische Kommission kann nun der Schweiz die unbefristete Verlängerung der Börsenäquivalenz verweigern – aller Voraussicht nach zerdeppert das mehr Geschirr, als nachher wieder zu kitten ist. Gewinner sind keine in Sicht, wenn die EU am 1. Juli 2019 ihre Drohungen wahr macht.
Wer auch immer aus welcher politischen Ecke der Parlamente und der offiziellen Stellen welche Haltung vertreten mag, am Schluss entscheidet in der Schweiz das Volk. Und so vernünftig die Schweizer in der Regel entscheiden, unter Druck gesetzte und abgestrafte Schweizer neigen nicht dazu, gefügig zu werden. Deshalb kann bei der wahrscheinlich durchgezogenen Strafaktion der EU der Schuss für alle Beteiligten kräftig nach hinten losgehen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aus einer schwierigen, aber grundsätzlich lösbaren Situation, ein Patt zu fabrizieren. Aktuell sind die Weichen genau dazu gestellt. In der Folge könnten sich die Diskussionen weniger um die Details eines Rahmenabkommens drehen, mehr um die Frage nach seiner grundsätzlichen Notwendigkeit. Und um Alternativen zu bilateralen Verträgen und um die Frage, ob mit den eingesparten Kohäsionsmilliarden, die Reisespesen in 28 Länder bezahlt werden könnten, mit denen man direkte Verträge aushandeln könnte, und, und, und.
Einmal in Fahrt, bekommen Empörung und Widerstand ein Gesicht, alternative Strategien erhalten Aufwind und führen zu Diskussionen, die neue Schwierigkeiten und Probleme nach sich ziehen, für alle Beteiligten.
Wir plädieren weiterhin für das Gespräch und für Verhandlungen. Egal, wem jetzt gerade medienwirksam der Geduldsfaden reisst. Unabhängig davon, ob die Schweiz ein mühsamer Verhandlungspartner ist. Auch dann, wenn der Abschluss eines Abkommens, in welcher Form auch immer, innerhalb der Amtszeit von Jean-Claude Juncker nicht mehr zu schaffen sein wird.
Der Plan, die Schweiz abzustrafen und in die Ecke des unartigen Kindes zu stellen, wird keine Früchte tragen, die dem abstimmenden Volk schmecken werden. Die Strategie "Jetzt aber vorwärts, unten rechts unterzeichnen, sonst kracht's", kann selbst nach erfolgter Unterschrift im Nachhinein durch das Volk durchkreuzt und gekippt werden. Dieses Risiko wächst, wenn sich Verhandlungspartner wie Gegner mit geladenen Waffen aufführen, bereit, diese bei Widerspruch auch abzufeuern. Das kommt nicht gut an und baut Widerstand auf.
Aktuell sprechen sich deutlich über 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung gegen einen EU-Beitritt aus. Diese ablehnende Haltung wird zusätzlich genährt durch Kommissionen und Verhandler, welche zum Zweihänder greifen, um Druck zu machen und Willfährigkeit zu erzwingen. Ein sicherer Weg, den Anti-EU-Reflex bei der Schweizer Bevölkerung markant zu festigen.
Es ist keine gute Idee, eine Spirale der gegenseitigen Abstrafungen im Sinne von Strafmassnahmen und Notwehr-Reaktionen in Gang zu setzen. Dazu steht zu viel auf dem Spiel. Nicht nur für die Schweiz, auch für die Europäische Union. Um Gewinner auf beiden Seiten zu produzieren, braucht's Augenhöhe bei Verhandlungen und Respekt im Umgang miteinander. Diese Aspekte scheinen gerade verloren zu gehen. Oder sind sie das schon länger?